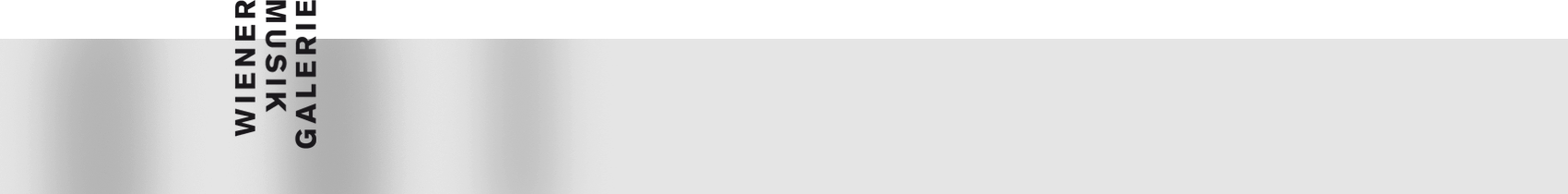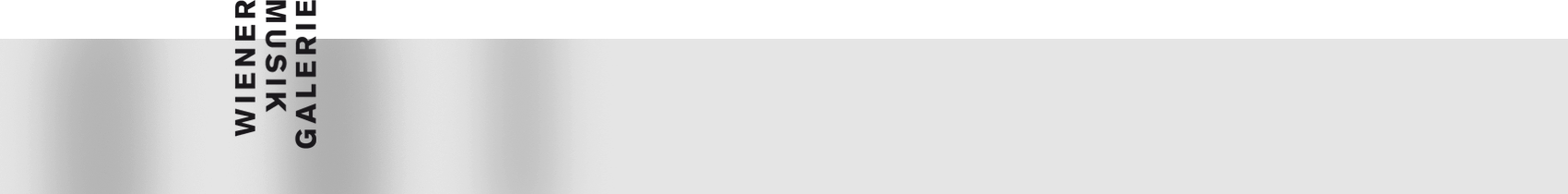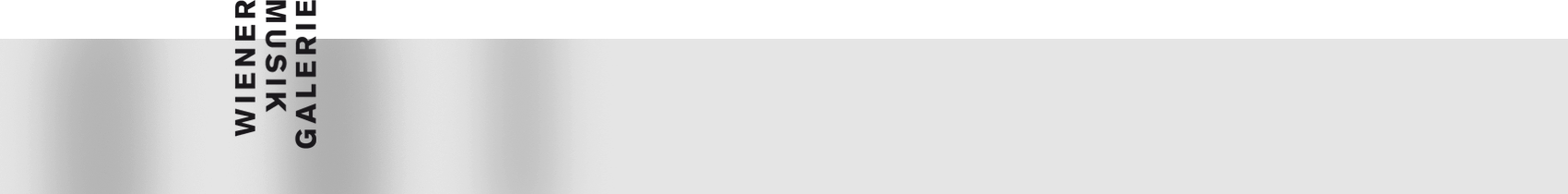
Robert Bilek
Revue passieren: 20 Jahre Wiener Musik Galerie
Kurzes Kurrikulum einer Institution
„Jazz ist eine wilde Musik,
bei der jeder spielt, was er will.“
(Alfred Bilek, mein Großvater)
Man mag von den 1980er-Jahren halten was man will, als Entstehungsdekade der Wiener Musik Galerie gebührt ihnen auf jeden Fall ein dicker Pluspunkt. Gründungsjahr 1982: Der Schauspieler Ronald Reagan war seit einem Jahr als US-Präsident im Amt und „The Man With the Horn“, das Comebackalbum von Miles Davis, auch nicht mehr ganz frisch; Sid Vicious war längst vermodert und der Punk kommerziell inhaliert; die Broker an der Wall Street und anderswo schnupften sich die Nasen wund.
Auf dem Wiener Terrain, das zu nächtlichem Leben erwacht war, tummelten sich zwischen dem Edelwirtshaus Oswald & Kalb und dem Café Alt-Wien noch Kunstexistenzen wie Hermann Schürrer, Ernst Schmidt junior oder Reinhard Priessnitz; an der Hochschule für angewandte Kunst sorgte Oswald Oberhuber für frischen Wind, während man Gemälde als Blue Chips handelte, junge Künstler von einem gierigen Kunstmarkt aufgesogen wurden und der Wiener Aktionismus am besten Weg war, zur Staatskunst verklärt zu werden; bunte New-Wave-Zacken wetterleuchteten ihre Neonfarben in eine fröhlich-kreative Atmosphäre, während die strenge Konzeptualität der Siebziger wie eine abziehende Gewitterfront elektrisierend nachwirkte und der Begriff Postmoderne – noch relativ weit entfernt von seinem Sturz aus der Popularität in die Trivialität – durch die Köpfe spukte. Das war die Geburtsstunde der Wiener Musik Galerie, die sich – als Produkt der Achtziger aus dem Geist der Siebziger – denn auch mit „No Punk – Free Wave“, dem Untertitel ihres ersten Festivals 1982, gleich gegen alle Tendenzen von Kunst und Musik quer in die Strömung stellte.
„Ich erlaube mir auf die Gründung des Vereins Wiener Musik Galerie hinzuweisen, welcher seine Hauptaufgabe in der Förderung bestimmter Aspekte von nicht kommerzieller aktueller Musik sieht“, schrieb Ingrid Karl in ihrer ersten Presseaussendung am 9. Dezember 1981. Und weiter: „Ich glaube, dass diese äußerst aktuelle und wichtige Tendenz in der Musikweltstadt Wien mit ihrem vornehmlichen Interpretenkult geflissentlich übersehen wird. Auch die Vereinigungen zeitgenössischer Komponisten sind offensichtlich nicht daran interessiert, von der hochkulturellen Rollenverteilung abzurücken. Aus diesen Gründen führen die mir interessant erscheinenden aktuellen Tendenzen in der gegenwärtigen Musik (New Jazz, Improvisationsmusik aller Richtungen, Integration von Komposition und Improvisation) in Wien ein erbärmliches Hinterhofdasein.“ Der kämpferische Impetus war von allem Anfang an unüberhörbar und wurde immerhin zwanzig Jahre lang durchgehalten. Die Wiener Musik Galerie hat damit den nachfolgenden großen Festivals zeitgenössischer Musik die Wege zum Publikum und zu neuen programmatischen Ansätzen geebnet.
Doch im Anfang war die Kunst. Das erklärt vor allem, weshalb sich die Konzertveranstalter Ingrid Karl und Franz Koglmann titelgebend als „Galerie“ verstehen wollten. Seit 1978 programmierten und organisierten sie in der Galerie nächst St. Stephan gemäß der Tradition der bereits von Monsignore Otto Mauer initiierten zeitgenössischen Musikaufführungen Konzerte. Den Anfang machte damals kein Geringerer als der Saxofonist Steve Lacy mit einem Solokonzert. 1980 folgte das 14-tägige Festival „Integrative Tendenzen in der heutigen Musik“ – ein nochmaliges großes Aufbäumen der musikalisch orientierten Performancekünste. Hermann Nitsch gab im Museum des 20. Jahrhunderts seine „Allerheiligensymphonie“, quasi ein klanglicher Vorgeschmack auf das 1984 realisierte „Drei-Tage-Spiel in seinem Prinzendorfer Schloss. Doch dann verloren Karl und Koglmann das Match gegen Rucki-Zucki-Palmenkombo und Co. Die Galerie nächst St. Stephan setzte – wie fast alle anderen auch – auf die neue, wilde Malerei, deren Protagonisten selbst in Punk- und New-Wave-Bands einer ganz anderen Art von Musik frönten. Die Rivalität führte letztendlich zu künstlerischem Mehrwert. Karl und Koglmann gaben nicht auf – und Dieter Ronte, damals Direktor des Museums Moderner Kunst in Wien, stellte seine Museumsräumlichkeiten zur Verfügung (was 1983 darin gipfelte, dass der englische Saxofonist Lol Coxhill im Foyer des Museums ein „Duokonzert“ mit Jean Tinguelys Klangmaschine „Métaharmonie“ spielte); spärliche Subventionen wurden versprochen; und mit einer Mischung aus totalem Idealismus und maximaler Selbstausbeutung ihrer Betreiber wurde die Wiener Musik Galerie in Schwung gebracht, um selbst etwas in der Wiener Musiklandschaft zu bewegen.
Die ersten drei Festivals – „Ex tempore Wien ’82“, „Tatitu Tatatu“ (1983) und „Ex tempore Wien ’84“ – waren der freien Improvisation gewidmet. Eingeladen wurde jeweils ein Pool von internationalen Musikern, die in unterschiedlichsten Formationen spontane Klangproduktion demonstrierten. Der holländische Cellist Tristan Honsinger, der italienische Klarinettist Gianluigi Trovesi oder der britische Schlagzeuger Tony Oxley etwa waren im ersten Jahr im Museum des 20. Jahrhunderts mit dabei. So spontan wie die Improvisationen war auch die Sofortbildfotografie von Heidi Harsieber, die das Festival dokumentierte und begleitete. Im Katalog schufen gezeichnete Kommentare der Musiker noch zusätzlich eine Atmosphäre sich frei entfaltender, geradezu übersprudelnder Kreativität. Ein Eindruck, der im folgenden Jahr von „Tatitu Tatatu“, dem buntesten WMG-Festival, noch überboten wurde. New Jazz, Chanson, Kammermusik, Mime, Zeichnung und Skulptur wurden aufgeboten, um mit einem geradezu zirkusartigen, synästhetischen Feuerwerk die Grenzen der Künste einmal mehr einer lustvollen Auflösung zuzuführen.
Gemessen an der explosiven Vielgestaltigkeit von „Tatitu Tatatu“, könnte das darauf folgende Festival „Ex tempore Wien ’84“ als Rückschritt angesehen werden. Tatsächlich wurde es nicht nur zu einer Sternstunde der Wiener Musik Galerie, sondern der frei improvisierten Musik überhaupt. Der britische Gitarrist Derek Bailey, erstmals in Wien, formierte acht Musiker unterschiedlichster Herkunft zu einer der legendären „Companies“, um mit ihnen seine Theorie von der „nicht idiomatischen Improvisation“ praktisch umzusetzen. Da trafen etwa die perkussiven Klänge des Südafrikaners Thebe Lipere auf die damals schon sehr „weißen“ Horn-Lines von Franz Koglmann; Meister Bailey selbst zupfte und klampfte weit jenseits von Frage und Antwort, motivischer Imitation oder gar Kaputtspielpathos unverdrossen drauf los und nebenher, während der Amerikaner George Lewis die auseinander strebenden Partikel und Fragmente mit der Magie weicher Posaunentöne einfing, um sie hinter dem Ohr der Hörer zu virtuellen Klangkonstrukten zusammenzuschweißen. Drei Tage lang lagerte das überaus zahlreich erschienene Publikum in den hehren Hallen des Palais Liechtenstein (des damaligen Hauptsitzes des Wiener Museums Moderner Kunst) und verfolgte das Entstehen einer Musik, die schon zu diesem Zeitpunkt ganz für sich alleine stand – ohne modische oder ideologische Stütze, ohne Lobby und ohne Industrie im Hintergrund.
„Ex tempore Wien ’84“ war aber nicht nur Höhepunkt einer Entwicklung, sondern gleichzeitig auch ein fulminanter Abschied der Wiener Musik Galerie von der Free Improvised Music. Bereits im Katalogheft zum ersten WMG-Festival ist ein handschriftliches Statement des niederländischen Pianisten Misha Mengelberg über „musikalische Improvisation“ abgedruckt: „Die ist als solches nicht so interessant. Man kann, wenn man sich ein wenig uebt, sich schnell entschliessen, etwas zu spielen – aber prinzipiel verschieden von langsame entscheidungen eventuell mittels noten oder ich weisz nicht welche preparationen um etwas zu spielen, ist dasz nicht. Wesentlich interessanter ist dabei wasz wird gespielt“ (Anm.: widergegeben in Originalschreibung).
Auch beim „Tatitu Tatatu Festival“ hatte sich das kompositorische Element bereits unüberhörbar eingeschlichen, als Koglmanns „Tanzmusik für Paszstücke“ uraufgeführt wurde – eine Ballettmusik mit dem Theater Paravent und Skulpturen von Franz West, die später auf der 1984 erschienenen LP „Schlaf Schlemmer, schlaf Magritte“ zu hören sein sollte, jener LP also, mit der Franz Koglmann den ersten großen Markstein auf seinem Weg vom Improvisator zum Komponisten setzte. Die Zielvorgabe der Wiener Musik Galerie für die folgenden Jahre hieß jetzt: Integration der Improvisation in die Komposition, wobei der Aspekt der Komposition – diesmal durchaus im Einklang sowohl mit internationalen Trends wie auch mit der persönlichen, künstlerischen Entwicklung des Musikers Franz Koglmann – mehr und mehr an Boden gewann.
Die Richtung stimmte, und mit „Jazz op. 3 – Die heimliche Liebe des Jazz zur europäischen Moderne“ gelang der Wiener Musik Galerie 1986 gleich wieder ein großer Wurf. Der Cool Jazz, die Ausläufer der Minimal Music, Schönberg und die Folgen sowie die persönlichen Modelle einiger formbewusster Pfadfinder des zeitgenössischen Jazz wie Steve Lacy, Bill Dixon oder Anthony Braxton wurden zu Referenzpunkten für einen neuen, von Wien aus initiierten Anlauf des oftmals abgeschriebenen und totgesagten Third Stream, jenes von Gunther Schuller in den 50er-Jahren so benannten Hybrids, das sich die ebenso lustvolle wie widersprüchliche Paarung der Intensität des amerikanischen Jazz mit dem formalen Anspruch der europäischen Kunstmusik zum Ziel gesetzt hatte. Mike Westbrook, das Orkest de Vollharding, Ran Blake mit seinen Filmmusik-Rekompositionen oder György Szabados zeigten nicht nur unterschiedliche Wege, mit Jazzkomposition umzugehen, sondern steckten auch ein musikalisches Universum ab, durch das Franz Koglmann sein Pipetet Richtung Zukunft manövrieren konnte. Untermauert wurde das ästhetische Konzept des Festivals durch ein 326 Seiten starkes Buch, das neben Essays zum Thema, historischen Aufarbeitungen des Third Stream, einer Umfrage unter Zeitgenossen zur Beziehung von Jazz und europäischer Kunstmusik auch eine Enzyklopädie der einschlägig aktiven Musiker enthält und das vom Erscheinen weg zu einem Standardwerk über den aktuellen Third Stream avancierte.
Im Nachhinein betrachtet verwundert es eigentlich, dass „Jazz op.3“ erst 1992, also sechs Jahre später, mit dem Festival „Incident in Jazz“ eine direkte Fortsetzung fand. Die zwei herausragenden Ereignisse dabei: André Hodeirs „Anna Livia Plurabelle“ für Sopran- und Altstimme, Jazzband und Kammerensemble, das wohl zu den spannendsten, ausgereiftesten und leider auch unterschätztesten Third-Stream-Kompositionen zählt, sowie die Wiederentdeckung des Stan-Kenton-Komponisten und -Arrangeurs Bob Graettinger. Auf abenteuerlichen Wegen gelang es, nicht bloß das Originalnotenmaterial für die Aufführung herbeizuschaffen, sondern auch eine Neurezeption Graettingers in Deutschland, Holland und den USA zu initiieren. Mit „Jazz op.3“ und „Incident in Jazz“ wurde die Mauer zwischen dem klassischen Musikbetrieb und dem weiten Feld von Jazz und Experiment wenigstens abschnittsweise perforiert. So etwa spielte der philharmonische Hornist Volker Altmann damals aus bloßem Interesse beim Graettinger-Projekt mit und brachte auch gleich noch einen seiner Schüler mit ins Ensemble – eine ungewöhnliche Geste zu jener Zeit. Ein Jahr zuvor war die Kommunikationsbasis zwischen Wiener Musik Galerie und Musikhochschule praktisch inexistent. Der WMG-Workshop von Anthony Braxton fand so gut wie ohne Hochschulstudenten statt.
Die Zeiten scheinen sich also geändert zu haben – zumindest ein bisschen. „Jazz op.3“ und „Incident in Jazz“ hatten aber noch einen weiteren Effekt, verbucht Franz Koglmann: „Die beiden Festivals haben ganz deutlich gezeigt, dass der Jazz nicht so tot ist, wie heute oft gesagt wird. Es gibt ja eine Reihe von Journalisten, die den Jazz gerne als Altherrenmusik totsagen, aber wie wir in Wirklichkeit wissen, ist das die wahrscheinlich wesentlichste musikalische Erneuerung des 20. Jahrhunderts, bis jetzt enorm einflussreich, wie man z. B. an der neuen Oper ,Der Balkon‘ nach Jean Genet von Peter Eötvös sieht. In Wirklichkeit ist doch ohne Jazzeinfluss gar nichts möglich. Weder die Popmusik noch international hoch im Kurs stehende Komponisten wie Steve Reich, John Adams oder Grenzgänger wie Heiner Goebbels und Gavin Bryars.“
Es ist kein Geheimnis, dass die Aktivitäten der Wiener Musik Galerie als eine Art Spiegel der musikalischen Entwicklung des Musikers und Komponisten Franz Koglmann gesehen werden können. „Der Koglmannsche Kosmos war und ist für mich die entscheidende Musikwelt. Aus diesem Geist heraus haben wir das Programm gestaltet. Die Wiener Musik Galerie schöpft aus dem Koglmann-Kosmos“, bekennt Ingrid Karl, die selbst wohl als das Herz der WMG bezeichnet werden muss. Das heißt freilich nicht, dass organisatorisches Herz und künstlerisches Hirn immer einer Meinung sind. Für das jüngste Festivalprogramm musste Koglmann einen bestimmten Programmpunkt gegen die skeptische Ingrid Karl durchsetzen. „Man muss sich bei der Auswahl auch aufs Gefühl verlassen und ein Risiko eingehen“, insistiert Koglmann. Die Zuteilung von Herz und Hirn ist also nicht immer so eindeutig, wie es von außen vielleicht erscheinen mag. Mehr als um Stile oder künstlerische Ideologien ging es in den Programmen der Wiener Musik Galerie stets um Persönlichkeiten.
Besonders deutlich zeigt sich das an den einer speziellen Musikerpersönlichkeit gewidmeten Festivals und an den Workshops. „Uns ist es nicht um Intrumentalunterricht gegangen“, sagt Ingrid Karl, „sondern um ,Konzept‘-Unterricht. Daher waren die Persönlichkeiten besonders wichtig.“ Die Namen können sich jedenfalls sehen und hören lassen. „Cool Noir – In memoriam Chet Baker“ (1988), „Beiderbecke – Assoziationen zu einem Mythos“ (1989) oder der Workshop „Reminiscin’ Duke – Zum 20.Todestag von Duke Ellington“ (1994) haben deutlich gemacht, dass das historische Fundament ein unverzichtbarer Bestandteil des Musikverständnisses von Karl und Koglmann ist, auch wenn manch ein hartgesottener Avantgardist im Publikum irritiert eine Augenbraue hob, als Musiker wie Warren Vaché oder Dick Sudhalter, die man sonst eher im Wiener Traditionsklub Jazzland orten würde, durch den langen Nachhall entrückte Chicago-Jazz-Sounds durch die Haupthalle der Secession wehen ließen.
Aber solch Verrückungen, Verfremdungen und Dekontextualisierungen gehörten und gehören nun einmal zum Stil der Wiener Musik Galerie, deren Anliegen es ja immer war, die Sinne zu schärfen, altes Zeug, das vielleicht längst schon im hintersten Winkel des Plattenregals verstaubt ist, wieder neu erfahrbar, in seiner Qualität erkennbar und für eine zeitgenössische Musizierhaltung nutzbar zu machen. „Wir wollten zeigen, dass alles in der Geschichte fußt“, sagt Ingrid Karl, „wir haben ja nicht beliebige Figuren der Jazzgeschichte nach Wien geholt, sondern Leute wie Jimmy Giuffre oder Lee Konitz, in deren Arbeit es einen hohen kompositorischen und reflektorischen Anteil gibt.“ Das trifft auch auf Steve Lacy zu, der 1987 einen Workshop leitete – drei Jahre später war ihm ein ganzes Festival gewidmet. Kein Wunder, ist er doch einer der frühen großen Mitstreiter Koglmanns und bereits auf alten Koglmann-Platten zu hören – einer der den Gestus des Free Jazz immer schon mit genialer Konstruktion und formaler Brillanz zu verbinden wusste.
Bis Anfang der 90er-Jahre verharrte die Wiener Musik Galerie in einer selbstgewählten Außenseiterposition, einer Art Splendid Isolation gegenüber den österreichischen Jazzinstitutionen. Die Workshops mit Michael Mantler, George Russell, Bill Dixon, Gil Evans, Steve Lacy / Steve Potts, John Zorn, Jimmy Giuffre, Anthony Braxton oder Lee Konitz konnten als Bewusstseinsappelle an die jungen Musiker hierzulande verstanden werden und als künstlerische Kriegserklärung an den Konservativismus und die Bierseligkeit der heimischen Jazzpolizei, die zu gewohnt war bestimmen, was diesseits und was jenseits der Kunstform Jazz lag. 1993 allerdings begab sich die Wiener Musikgalerie gewissermaßen ins Zentrum der österreichischen Jazzmythologie und ehrte mit dem Festival „Hans Koller – The Man Who Plays Jazz“ den unumstrittenen Doyen der heimischen Szene. Koller erwies sich als WMG-kompatibel aufgrund seiner Cool-Jazz-Kompetenz und wegen seines niemals nachlassenden Willens zum – natürlich auch formalen – Experiment. Der Coup bei diesem Festival lag jedoch ganz woanders: nämlich bei dem Pianisten Pierre-Laurent Aimard, der im Wiener Konzerthaus mit unglaublicher Verve György Ligetis „Études pour piano“ (jenen Mix aus europäischen und afrikanischen Konstruktionskonzepten, der es einem einzigen Spieler durch Überlagerung unterschiedlicher rhythmischer Gitter und durch Überlistung der Wahrnehmung ermöglicht, mehrere Geschwindigkeitsschichten gleichzeitig zum Klingen zu bringen) für ein ebenso dankbares wie anspruchsvolles Jazzpublikum aufführte. Und das zwei Jahre bevor Aimard in Salzburg ganz groß herauskam. Dieses Konzert darf getrost zu den „unvergesslichen“ gezählt werden – für die Wiener Musik Galerie war es ein Triumph.
Während Karl und Koglmann in Bereichen des Klassikbetriebs punkteten (1994 war das Festival „Parallel Worlds“ Bestandteil des Festivals Wien modern), zeigte sie auch auf dem Feld des Jazz Stärke: 1994 mit dem Workshop „Reminiscin’ Duke“ – zu dem Ellington-Veteranen wie Clark Terry, Norris Turney, Britt Woodman, Jimmy Woode oder Louie Bellson anreisten –, der aber auch in engem Schulterschluss mit der Jazzabteilung des Konservatoriums der Stadt Wien, mit der Konservatoriums-Big-Band unter Bill Dobbins und mit der fachkundigen Hilfe von Heinz Czadek stattfand. Die Wiener Jazzszene und die Wiener Musik Galerie waren sich so nahe gekommen wie nie zuvor.
Mitte der 90er-Jahre war das Workshopkonzept der Wiener Musik Galerie vollendet. Die Durchlässigkeit zwischen Jazz und zeitgenössischer E-Musik ist für viele junge Musiker zur Selbstverständlichkeit geworden. Viele der ehemaligen Workshopteilnehmer können auf eine stattliche Anzahl eigener, eigenwilliger Projekte zurückblicken. Als Impulsgeber hat die Wiener Musik Galerie diesbezüglich eine unbestreitbare Rolle gespielt, gleichzeitig muss man ihr zugute halten, dass sie die von ihr geförderten Musiker – auch den engsten Kreis – niemals über Gebühr vereinnahmt hat. Eine „WMG-Schule“ existiert – glücklicherweise – nicht. Wohl aber eigenständige Künstlerpersönlichkeiten wie Burkhard Stangl, Hans Steiner oder Oskar Aichinger, die zur Wiener Musik Galerie ein gewisses Naheverhältnis haben oder während einer bestimmten Phase ihrer Entwicklung hatten.
Was die rezente Phase der Wiener Musik Galerie angeht, so ist das Unternehmen aus seinem heroischen Zeitalter wohl herausgewachsen. Neues Terrain gibt es kaum noch zu erobern, Jazzklubs bieten ein anspruchsvolles, stilistisch in alle Richtungen offenes Programm das ganze Jahr über. „Heute sind auch die Interessierten überernährt“, charakterisiert Koglmann die Situation und die Schwierigkeit, eine Nische im dichten Konzertangebot zu besetzen. Zudem scheint jene Spezies von Musikhörern, die dereinst ohr- und hirnbelastende Klänge gerne als Zeichen des Widerstands gegen allzu glatte Marktmechanismen und als Abgrenzung gegen die Dumpfheit nützten, langsam, aber sicher auszusterben. Musik soll vor allem Spaß machen, so die zirkulierende Losung; kaum ein Jazzfestival kommt noch ohne Pop-Acts aus, und von einem jüngeren Publikum wird Jazz ohnehin nur noch wahrgenommen, wenn er über hypnotische House-Rhythmen phrasiert wird. Das alles ist zwar kein Grund für ein nostalgisches Lamento, macht die Situation für Veranstalter mit programmatischen Absichten aber nicht gerade leichter.
Die Wiener Musik Galerie – von Beginn an Virtuose im Zwischen-den-Stühlen-Sitzen – sucht ihren Weg in der konsequenten Weiterentwicklung des Begonnenen: Jazz mit Nähe zur Komposition, Komponisten mit Nähe zum Jazz. Das Festival „Icebreaker“ 1999 war eine der deutlichsten Formulierungen dieser Absicht. Musik, inspiriert durch den holländischen Querdenker Louis Andriessen, Post-Minimalism, kantig aufgerauht, Musik über Musik, aber nicht als Folge der Folgen der Folgen von Darmstadt, sondern mit Blick vor allem auf jene Strömungen, die in den Konzertsälen des angelsächsischen Raums zählen. Doch neben jazzinfizierten Kompositionen gibt es immer wieder auch den Rückgriff auf den „wirklichen“ Contemporary Jazz – wie ihn etwa Ellery Eskelin 2000 bei „Answers in Progress“ repräsentierte. Oder es werden Musiker ins Spiel gebracht, die ihre Affinität zur Rockmusik über fein ziselierte kompositorische oder auch improvisatorische Strukturen auf so unterschiedliche Weise ausleben wie der deutsche Gitarrist Andreas Willers oder der Minimal-Music-Berserker Steve Martland. Franz Koglmann, der „Berater“ der Wiener Musik Galerie, lässt die Zügel mit voller Absicht etwas schleifen, das „Koglmann-Universum“ hat eine gewisse Stabilität erreicht, muss sich heute nicht mehr permanent selbst erschaffen: „Früher habe ich alle Programme auf meine Linie gebracht. Heute ist das nicht mehr notwendig. Diese Linie ist international längst etabliert und anerkannt – was aber nichts über ihren wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg aussagt. Ich lasse heute auch gerne Sachen zu, die nicht im engeren Sinn meiner persönlichen Ausrichtung entsprechen.“
Dass die Wiener Musik Galerie das Feld der sowohl im Dance- wie auch im Experimentalbereich boomenden elektronischen Musik anderen, nachfolgenden Generationen überlässt, fußt auf einer bewussten Entscheidung, die respektiert – oder besser: sogar begrüßt – werden sollte. Scheint es heute doch auch jenseits konservativer Haltungen wesentlich zu sein, Positionen zu behaupten und mit Sorgfalt präzise Weiterentwicklungen innerhalb eines Gebietes, aus einem bestimmten Blickwinkel zu ermöglichen und sichtbar zu machen, anstatt sich von den Trends der musikalischen Erlebnisgastronomie – so interessant die vielleicht auch sein mögen – mitreißen zu lassen. Keine Frage, dass nur darin die Zukunft der Wiener Musik Galerie liegen kann.
Und keine Frage, dass dafür – wie schon bisher – ein ungeheurer Aufwand an ästhetischen Gesamtkonzeptionen zu erbringen sein wird: Aufträge an Musiker ebenso wie an Schreiber, die das Gehörte reflektieren, an Grafikdesigner, die dem Wort „Galerie“ im Titel gerecht werden und die komplexen Gedanken hinter den programmatisch-musikalischen Konstellationen auf eine lesbare optische Formel bringen. Die Arbeit, die die Wiener Musik Galerie in den letzten zwanzig Jahren geleistet hat, kann nur dann richtig eingeschätzt – und damit auch geschätzt – werden, wenn man die enorme kommunikative Vernetzung mit einrechnet, die zwischen den unterschiedlichsten künstlerischen, wissenschaftlichen oder journalistischen Szenen geleistet wurde.
Unzeitgemäßer Weise stand hinter dieser Leistung immer die Stärkung von Ideen und niemals die Verwertung derselben. Rückblickend erkennt Franz Koglmann denn auch zwei ebenso gravierende wie sympathische Marketingfehler: So hat die Musikgalerie in zwanzig Jahren keinen feststehenden Festivalnamen als Logo etabliert, und das Publikum durfte sich niemals an eine fixe Location gewöhnen. Koglmanns lakonischer Kommentar dazu zeigt, dass das wohl auch in Zukunft so bleiben wird: „Nomaden wie wir haben es schwer – aber darin liegt letztlich auch ein großer Reiz und eine enorme Herausforderung.“